Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Wahrnehmung und Gedächtnis
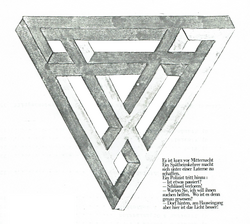
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Wahrnehmung & Gedächtnis
Das Verhältnis von Wahrnehmung und Gedächtnis scheint, vor dem Hintergrund der Computer-Metapher vollkommen unproblematisch zu sein:
Wahrnehmung ist der Input, Gedächtnis ist die Magnetplatte, und dem Lernen entspricht das Einlesen. Das Gehirn jedoch gehört, um im Bild zu bleiben, zu einer 'Computergeneration' die erst noch geschaffen werden muß, d.h. eine Sprachregelung die sich Begriffen wie Input, Output, Buffer, Central-Processing-Unit usw. bedient, ist zur adäquaten Erfassung von Gedächtnisphänomenen nur wenig geeignet.
Ganz entgegen Harres oben referierten Forderungen nach existentiellen Hypothesen wird durch die Sprache der Informatik der Blickwinkel für das Gedächtnis nicht erweitert, sondern eingeschränkt.
In Nachschlagewerken für psychologische Fachsprache[1][2] wird Gedächtnis z.B. als 'neuerliches Bewußtwerden' vergangener Wahrnehmungen beschrieben. Damit ist bereits ein Bereich angesprochen, der nicht in Termini der Computer-Metapher beschrieben werden kann. Auch eine Charakterisierung als 'Medium der Informationsspeicherung ebenso wie der Informationsverarbeitung' überfordert dieses Vokabular: Ein Speicher, der selbstständig Information verarbeitet, ist nicht vorgesehen!
Verläßt man konsequenterweise das Feld der Computer-Metapher so wird die Trennung von Gedächtnis und Wahrnehmung sehr schnell zum Problem:
"Die lineare Hintereinanderreihung verschiedener Speicher läßt sich nur darstellungsökonomisch legitimieren, faktisch handelt es sich um beständig ineinandergreifende Verarbeitungsschleifen, in denen Mustererkennung als Erzeugung zielorientierter kontextsensitiver semantischer Beschreibungen abläuft."[3]
Versucht man die Trennung von Wahrnehmung und Gedächtnis vom Begriff der Wahrnehmung aus zu entwickeln, so entstehen ähnliche Schwierigkeiten:
Eine Beschreibung als 'Aufnahme und Verarbeitung von äußeren und inneren Reizen durch den Organismus zum Zweck der Informationsgewinnung' ist wenig hilfreich, da eine Verarbeitung ohne Einbeziehung von Gedächtnisinhalten eben kaum plausibel zu machen ist.
Eine provisorische Lösung bestünde darin, Verarbeitung als Strukturierungs-Prozesse anzusehen, die durch den Aufbau der Rezeptoren determiniert sind. Damit wäre das Gedächtnis solange 'aus dem Rennen' bis sich zeigen ließe, daß die Reaktionen der Rezeptorsysteme durch Erfahrung modifiziert werden.
Wie sich in den folgenden Kapiteln allerdings noch zeigen wird, ist eine Lernfähigkeit auch sehr weit an der Peripherie gelegener Partien der Sinnesorgane durchaus anzunehmen. - Was nun?
Wie sich meiner Ansicht nach bereits aus den Überlegungen HERBARTs[4] heraus erkennen läßt, ist es nicht möglich, Sätze über höhere geistige Prozesse zu formulieren, ohne sich in irgendeiner Weise auf Gedächtnisprozesse zu beziehen. Das kann zweierlei Konsequenzen nach sich ziehen:
- Der Term 'Gedächtnis' wird sehr eng gefaßt. Er wird weder für Prozesse im Bereich der Wahrnehmung noch für sonstige höhere geistige Prozesse verwendet, sondern ausschließlich als Etikett für die Hinterlassenschaften gewisser zentralnervöser Vorgänge. Gedächtnis ist dann kein Prozess, sondern ein Produkt. Dies schließt eine Plastizität und zeitliche Instabilität nicht aus. Wichtig ist aber die vollständige Einschränkung des Gedächtnisbegriffs auf den Permanenzaspekt. Wahrnehmung ist danach etwas leichter zu fassen. Da die Prämisse 'keine Wahrnehmung ohne Gedächtnis' weiterhin aufrecht erhalten werden soll, liegt es nahe, die bisher als 'Kurzzeitgedächtnis'[5] (short-term-memory = STM) bezeichnete dynamische Komponente des Gedächtnisses nun als einen Teil der Wahrnehmungsprozesse zu betrachten.
- Das gesamte ZNS wird als Gedächtnis betrachtet; alle ablaufenden Vorgänge sind Gedächtnisprozesse. Das führt zur Vorstellung eines ungeheuer komplexen Informationsspeichers dessen Speicherinhalt einer ständigen Umordnung und, durch zeitweiliges Abgleichen mit der Umgebung, Aktualisierung unterworfen ist. Dieses Abgleichen kann ohne Schwierigkeiten als Wahrnehmung bezeichnet werden.
Auch wenn er es nicht explizit gemacht hat, so hat HERBART sich bei der Formulierung seiner Gedanken sehr stark von der zweiten Alternative leiten lassen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Alternativen besteht in der Tat nur in der Verwendung des Gedächtnisbegriffs und nicht etwa in verschiedenen Prämissen, was Gliederung und Ablauf der Informationsverarbeitung betrifft.
Ich will in dieser Arbeit der ersten Alternative den Vorzug geben. Nur der dort verwendete Gedächtnisbegriff ist als Basis für eine überschaubare Untersuchung von Modellen des Gedächtnisses geeignet. Im Fall der zweiten Alternative dagegen stände man vor einer Aufgabe, die günstigstenfalls inhaltsleer wäre, da Versuche, das gesamte ZNS zu modellieren, zu bislang wenig interessanten Ergebnissen geführt haben.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ Dietrich,G. & Walter,H. (1970): Grundbegriffe der psychologischen Fachsprache.
- ↑ Grubitzsch,S. & Rexilius,G.%(1981): Handbuch psychologischer Grundbegriffe
- ↑ Norman & Bobrow (1967) aus GRUBITZSCH/REXILIUS (1981) S.367
- ↑ vgl. Kap.2: 'Wieviel?'
- ↑ vgl. Pribram,K.H. & Broadbent,D.E. (1970): Biology of Memory - Part I: Analysing the Issues.